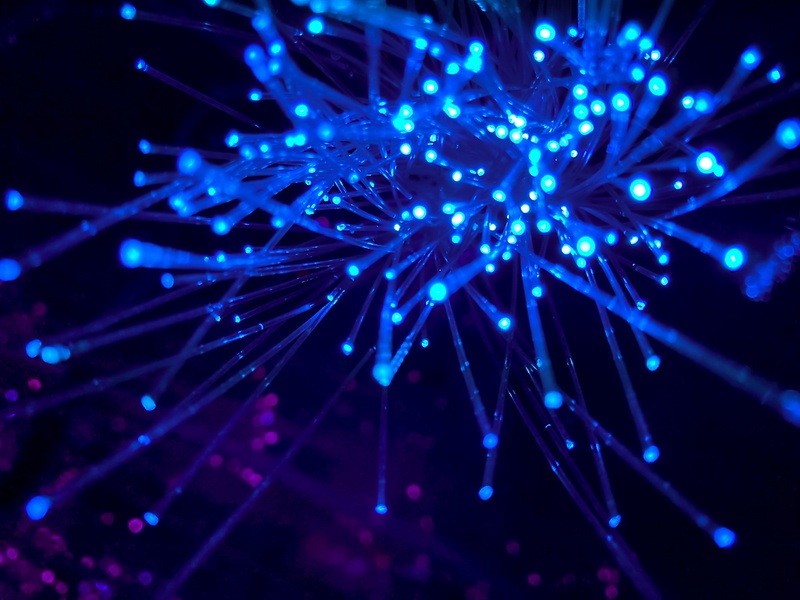25. Juli 2025 von Stefan Trockel
Agentic AI: Warum 2025 das Jahr der autonomen KI-Agenten ist. Ein Reality-Check
AI-Agenten sind DAS Hypethema 2025. Überall hört man von autonomen KI-Systemen, die selbstständig Aufgaben erledigen, Entscheidungen treffen und komplexe Workflows orchestrieren. Google, Salesforce, Microsoft, und viele andere integrieren "agentische" Features in ihre Enterprise-Tools. Startups bauen Geschäftsmodelle auf Basis von Agenten. Und auf LinkedIn erzeugen Demo-Videos von beeindruckenden Prototypen „next-level FOMO", die den Impuls auslösen: „Muss ich auch haben!“.
Doch zwischen den „unglaublichen" Demos und der rauen Produktionsrealität klafft eine gewaltige Lücke. Viele "Agenten" sind in Wahrheit nur Workflows mit LLM-Knoten. Die versprochene Magie entpuppt sich als Kombination aus strukturierter JSON-Ausgabe, deterministischem Code und gezielter Steuerung.
Bedeutet das, dass der Agent-Hype unberechtigt ist? Keineswegs. Für bestimmte Use Cases ist tatsächlich der Punkt erreicht, wo Vertrauen in die Zuverlässigkeit und erwarteter Business Value den produktiven Einsatz von Agenten nahelegen. Der Schlüssel liegt darin, die Illusion von der Realität zu trennen und zu verstehen, was Agenten wirklich sind – und was nicht.
Mit diesem Blog-Beitrag werde ich hinter den Hype blicken und euch einen Reality-Check bieten. Ich werde Begriffe klären, Verständnis für wichtige Grundprinzipien von Agenten schaffen und auf praktische Aspekte der Implementierung schauen. Dabei zeige ich euch, was alles zu bedenken ist, um die Kluft zwischen beeindruckenden Demos und zuverlässigen Produktivsystemen zu überbrücken. Denn auch wenn der Hype um Agenten fast schon nervt, ist das Potenzial agentischer Lösungen zu groß, um sich damit nicht konkret zu befassen.
Was ist eigentlich ein Agent? Und was nicht?
Fragt man zehn Entwicklerinnen oder Entwickler nach ihrer Definition eines AI-Agenten, erhält man zwölf verschiedene Antworten. Diese begriffliche Verwirrung ist kein Zufall – sie spiegelt die rapide Evolution des Feldes wider. Und den Bedarf an Begriffsschärfung.
Der Begriff "Agent" wird inflationär und oft falsch verwendet. Viele Systeme, die als "Agenten" bezeichnet werden, sind in Wahrheit nur modulare Softwarekomponenten mit LLM-Integration.
Beispiel aus der Praxis: Ein Workflow, der Bestellungen aus E-Mails extrahiert und in SAP anlegt, nutzt zwar LLMs für die Textverarbeitung – ist aber kein Agent. Es ist eine Prozessautomation mit fest definierten Schritten. Wertvoll? Absolut. Ein Agent? Nein.
Was macht dann einen echten Agenten aus? Eine pragmatische Definition beschreibt Agenten als autonome Softwarekomponenten, die Werkzeuge nutzen, um Ziele zu erreichen, ohne dass jeder einzelne Schritt explizit vorgegeben wird. Darin stecken zwei entscheidende Kriterien:
Autonomie
Die Fähigkeit des Agenten, aufgrund von Kontext und Reflexion des eigenen Handelns Entscheidungen über die auszuführenden Aktionen zu treffen.
Konkretes Beispiel: Ein Coding-Agent bekommt die Aufgabe "Implementiere eine API für Benutzerverwaltung". Er analysiert selbstständig die Anforderungen, wählt das passende Framework, erstellt die Datenbankstruktur, implementiert Authentifizierung und schreibt Tests – dabei trifft er eigenständig Architekturentscheidungen basierend auf Best Practices und Projektkontext. Kein starres Template, sondern intelligente Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten.
Handlungsfähigkeit
Die Möglichkeit für den Agenten, mit ‚der Welt' zu interagieren – also nicht nur Text-Outputs zu erzeugen, sondern Aktionen auszuführen.
Konkretes Beispiel: Ein IT-Support-Agent gibt dir nicht die Anleitung aus, wie du deinen Internet-Router konfigurierst, sondern nimmt die Konfiguration für dich vor. Er loggt sich ein, ändert Einstellungen und verifiziert das Ergebnis.
Der Blick in die Realität zeigt uns ein Spektrum der Agentizität:
- Minimal-Agenten führen einfache Schleifen aus und entscheiden, wann sie fertig sind.
- Task-Agenten wählen zwischen verschiedenen Werkzeugen basierend auf der Aufgabe.
- Reflexive Agenten bewerten ihre eigenen Ergebnisse und passen ihre Strategie an.
- Proaktive Agenten erkennen Probleme, bevor sie auftreten, und handeln präventiv
Die meisten "Agenten" in Produktion bewegen sich aktuell am unteren Ende dieses Spektrums. Und das aus gutem Grund.
Die neue Herausforderung für Enterprise IT
Die Delegierung von Entscheidungen an probabilistische autonome Systeme bedeutet im schlimmsten Fall Kontrollverlust bei gleichzeitig voller Verantwortung für das Ergebnis. Es stellen sich gänzlich neue Fragen:
- Wie balanciere ich Autonomie und Kontrolle in einer Agentenarchitektur?
- Wie gehe ich mit Identität, Vertrauen und Berechtigungen für autonome Agenten um?
- Wie arbeiten meine menschlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Agenten zusammen?
Das Gute ist, Agenten sind keine Magie, sondern Software
Bevor euch nun die Sorge vor dem Kontrollverlust überkommt, hilft wieder eine Dosis Realität: KI-Agenten sind keine Magie, sondern modulare Software mit klar definierten Schnittstellen. Was angesichts des Hypes vielleicht ernüchternd klingen mag, ist in Wirklichkeit befreiend.
Unter dem intelligenten, autonomen Verhalten eines Agenten liegt meist eine Kombination aus:
- Strukturierter JSON-Ausgabe der Modelle
- Deterministischem Code für kritische Pfade
- Gezielter Steuerung durch Konfiguration
Der "Agent" übersetzt die LLM-Ausgabe in JSON-Form in deterministische Codepfade. Dabei designen wir die Freiheitsgrade und Kontrollmechanismen. AI-Engineers und Architektinnen beziehungsweise Architekten justieren diese passend zum spezifischen Risikoprofil eines Anwendungsfalls.
Kostenloses Whitepaper
Agentic AI – Der nächste Evolutionssprung für KI-Anwendungen
Erfahrt, wie agentenbasierte KI die Grenzen klassischer Systeme sprengt und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet. Unser Whitepaper zeigt praxisnah, wie Agentic AI funktioniert – und warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einzusteigen.
Jetzt kostenlos herunterladen und einen Blick in die Zukunft der KI werfen
Architektur-Muster für erfolgreiche Agenten
Die erfolgreichsten Agenten-Implementierungen folgen einem gemeinsamen Prinzip: Kleine, fokussierte Agenten mit klar abgegrenzten Verantwortungsbereichen statt monolithischer Super-Agenten. Diese "Micro-Agenten" behalten ihre Autonomie, operieren aber in definierten Kontexten.
In der Praxis dominieren fünf zentrale Design-Patterns:
- 1. Chaining: Verkettung von LLM-Schritten, wobei der Output eines Schritts zum Input des nächsten wird. Ideal für mehrstufige Analysen oder Verarbeitungsprozesse.
- 2. Routing: Der Agent entscheidet basierend auf dem Input, welche Unterwerkzeuge oder Pfade genutzt werden. Perfekt für Klassifizierungsaufgaben mit unterschiedlichen Folgeprozessen.
- 3. Parallelisierung: Gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Aspekte für bessere Performance. Besonders wertvoll bei unabhängigen Teilaufgaben.
- 4. Orchestrator-Workers: Ein Haupt-Agent teilt komplexe Aufgaben auf spezialisierte Unter-Agenten auf. Das Master-Pattern für komplexe Systeme.
- 5. Evaluator-Optimizer: Selbstbewertung und iterative Verbesserung der eigenen Outputs. Essenziell für die Qualitätssicherung.
Diese Muster sind keine theoretischen Konzepte. Sie funktionieren. Heute. In Produktion.
Memory-Management: Der unterschätzte Erfolgsfaktor
Erfolgreiche Agenten vergessen gezielt. Sie implementieren:
- Ein Kurzzeitgedächtnis für den aktuellen Kontext,
- ein Langzeitgedächtnis für wichtige Fakten und Präferenzen,
- ein episodisches Gedächtnis für vergangene Interaktionen sowie
- Verfallsmechanismen für irrelevante Informationen.
Ein Agent ohne intelligentes Memory-Management erstickt nach drei Tagen im Datenmüll. Mit richtigem Memory läuft er monatelang stabil.
MCP: Der neue Standard für Tool-Use durch Agenten
Stellt euch das Model Context Protocol (MCP) wie einen App-Store für Agenten-Fähigkeiten vor. Während die Verwendung von Werkzeugen bisher immer individuelle Integrationen erforderte, steht mit dem MCP nun eine Plug-and-Play-Architektur zur Verfügung.
Ein praktisches Beispiel: Ein Datenanalyse-Agent entdeckt während seiner Arbeit, dass er ein neues Visualisierungs-Tool benötigt. Früher hätte das eine Entwicklerin oder einen Entwickler erfordert, die oder der die Integration programmiert. Mit dem MCP kann der Agent:
- das Tool selbstständig über den MCP-Registry finden,
- prüfen, ob seine Auth-Policy die Nutzung erlaubt,
- das Tool einbinden und nutzen und
- die Nutzung transparent loggen.
Das löst elegant das Dilemma der Autonomiekontroll: Der Agent kann selbstständig neue Werkzeuge nutzen (Autonomie), aber nur solche, die über das MCP registriert und für seinen Kontext freigegeben sind (Kontrolle).
Governance: Die neue Realität der Kontrollabgabe
Das Beispiel führt uns zurück zu der Frage der Agent Governance. Denn Agenten Autonomie entlässt uns nicht aus der Verantwortung. Allerdings erfordert die Kontrollabgabe an autonome Systeme neue Governance-Modelle.
An dieser Stelle kann es übrigens helfen, wenn ihr euch bewusst macht, dass auch eure menschlichen Kolleginnen und Kollegen ab und zu Fehler machen und zu schauen, wie ihr damit in eurer Organisation umgeht. Es gibt selbstverständlich viele Unterschiede, aber eine bewusste Fehlerkultur wird es auch für Agenten brauchen.
In der Praxis liegt die Lösung meist nicht in totaler Kontrolle oder blindem Vertrauen, sondern in hybrider Mensch-Agent-Kollaboration.
Klare Entscheidungspunkte sind hier essenziell. Der Agent muss wissen,
- wann er autonom entscheiden darf,
- wann er nachfragen sollte und
- wann er eskalieren muss.
Von der Demo zur Produktion
Die Governance-Fragen zeigen: Agenten zu verstehen ist eine Sache – sie produktiv einzusetzen eine ganz andere. Zwischen den beeindruckenden LinkedIn-Demos und der rauen Produktionsrealität klafft eine gewaltige Lücke. Und genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
Ein Proof of Concept ist schnell gebaut. Ein paar API-Calls, ein bisschen Prompt Engineering und schon löst dein Agent im geschützten Raum beeindruckende Aufgaben. Doch dann kommen die unbequemen Fragen: Wie verhält sich der Agent bei 10.000 Anfragen täglich? Was passiert bei Edge Cases, an die niemand gedacht hat? Wie integriert er sich in bestehende Systeme mit all ihren Legacy-Eigenheiten? Und vor allem: Wie stellt ihr sicher, dass er in drei Monaten noch genauso zuverlässig funktioniert wie am ersten Tag?
Der pragmatische Weg nach vorn
Was also tun? Die erfolgreichsten Agent-Implementierungen folgen klaren Prinzipien:
- 1. Klein anfangen, gezielt wachsen: Jeder Agent eine Aufgabe. Komplexität beherrschen wir durch Orchestrierung, nicht durch Super-Agenten.
- 2. Memory mit Verfallsdatum: Nicht alles merken, gezielt vergessen. Ein Agent, der weiß, was er nicht wissen muss, ist ein guter Agent.
- 3. Frameworks können helfen, aber auch zusätzliche Komplexität bringen: Nutze Abstraktion, aber verstehe, was darunter passiert. Manchmal ist ‚simples Python‘ einfacher als ein abstraktes Framework.
- 4. Monitoring ab dem ersten Tag: Agenten sind schwer zu debuggen. Ohne ordentliches Logging und Tracing bist Du blind.
Fazit: Agenten sind da – nutze sie richtig!
2025 ist das Jahr der Agenten, weil wir endlich verstehen, was sie sind: Keine magischen Problemlöser, sondern gut orchestrierte Softwarekomponenten. Die Standards existieren, die Patterns sind erprobt, die Tools sind da.
Der Schlüssel liegt nicht darin, den perfekten autonomen Agenten zu bauen. Es geht darum, die richtigen Agenten für die richtigen Aufgaben zu entwickeln und sie sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren.
Agenten verändern, wie wir arbeiten – aber nur, wenn man sie versteht, kontrolliert und verantwortungsvoll einsetzt. Der Hype mag nerven, aber das Potenzial ist real. Zeit, es zu nutzen.
Bereit für den nächsten Schritt mit Agentic AI?
Bei adesso unterstützen wir Unternehmen dabei, die Potenziale von AI-Agenten zu erschließen – von der Strategieentwicklung über die Architektur bis zur produktiven Implementierung. Unsere Fachleute helfen euch, die richtigen Use Cases zu identifizieren, robuste Agent-Systeme zu entwickeln und diese sicher in eure Enterprise-Umgebung zu integrieren.
Erfahrt mehr zu Agentic AI mit Google, Microsoft oder Salesforce